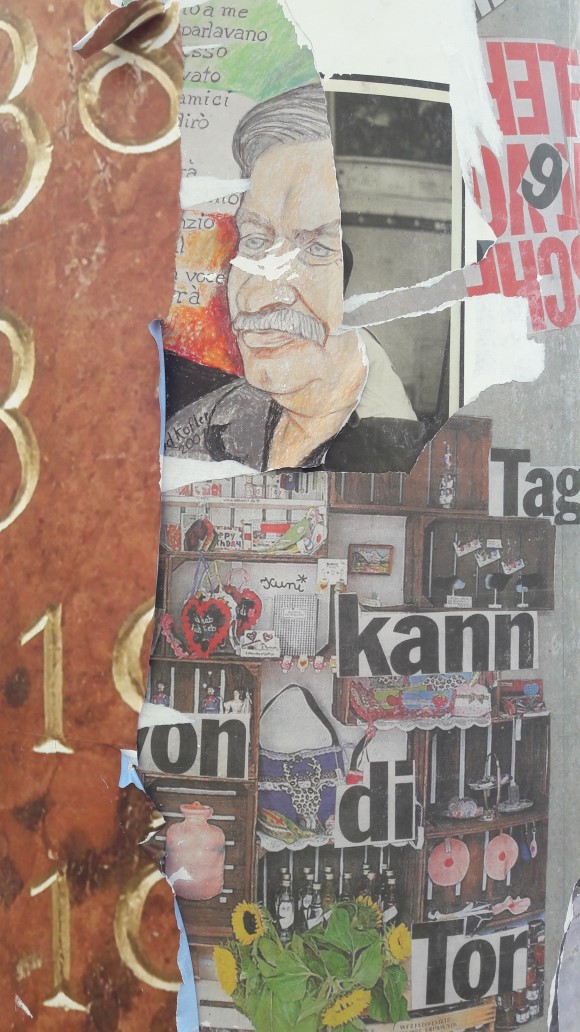
24 März Satzanfänge
Als Julian Barnes beschloss Schriftsteller zu werden, schwor er, das Wetter in seinen zukünftigen Romanen auszusparen. Er wollte ihm neben Ort und Personen der Handlung keine Rolle geben, auch nicht, es als ein Mittel einsetzen, um Stimmungen herauszuarbeiten.
Ich nahm mir vor, es auch so zu halten, aber neben dem Wetter, auch noch die Orte einer fiktionalen Handlung unbenannt zu lassen und den Protagonisten, falls sie eine tragende Rolle spielen sollten, keinen Namen zu geben oder gar Verwandtschaftsverhältnisse anzudeuten. Auch die Zeit sollte nicht vorkommen. Warum etwas, das ich mir ausgedacht hatte, an Raum und Zeit binden? Und die dramaturgischen Regeln? „Willst du die etwa auch nicht beachten?“, fragte mich eine nervös gewordene innere Stimme, die von dem ganzen Ansinnen ein Schriftsteller werden oder sein zu wollen, wenig hielt, wie mir schien.
„Doch. Die dramaturgischen Regeln, wenn man unter diesen Einleitung, Hauptteil und Schluss verstehen will, wie man das in der Schule für den Aufsatz gelernt hat, die müssen eingehalten werden“, versuchte ich sie zu beruhigen.
„Na, dann fang mal an!“, hat sie gemeint und dabei geschmunzelt. „Lass dich nicht aufhalten!“
Nachdem ich also so die Parameter festgelegt hatte, die für das, was ich schreiben wollte, gelten sollen, begann ich einen Satz zu suchen, der diesen Ansprüchen genügt. Ich will dich nicht langweilen mit den vielen Versuchen, die ich unternahm, mit einem Satz einzuleiten, in welchem weder eine bestimmte Zeit, noch weniger ein konkreter Ort, vielleicht eine Person ohne verwandtschaftlichen Hintergrund, aber auf gar keinen Fall das Wetter vorkommen durfte. Aber du kannst dir vorstellen, dass dies ein Unterfangen war und leider bleibt, das mich – hier das Ich eines Autors, dem bis zu diesem Zeitpunkt jede Legitimation fehlt, sich als solchen zu begreifen – vollkommen überfordert hat und es noch im Augenblick tut, da du diese Zeilen liest. Trotzdem will ich dir einen dieser Sätze nicht vorenthalten: „…Er wusste Dinge, die andere nicht wussten. Erst das, was niemand von ihm wusste, erlaubte ihm, sich selbst zu kennen…“ Auch wenn dieser Satz die Kriterien erfüllte, (du weißt mittlerweile: kein Ort, keine Zeit, vor allem kein Wetter), die ich mir als Autor, der sich beim Schreiben ja in zwei Wesen spaltet, aufgestellt hatte, so schnell hatte ich ihn auch schon wieder verworfen. Jetzt nämlich hätte ich diese Dinge benennen müssen. Sobald ich sie aber benannt, nein: bekannt hätte, wären es keine Geheimnisse geblieben, und die Behauptung hätte sich selbst widerlegt. Es wäre mir wie Verrat an der Person vorgekommen, die ich mit diesem Satz ins Leben gerufen hatte. Irgendein bis zu meiner Schöpfung namenloser „Er“. Das hatte er nicht verdient. So kann man mit Menschen nicht umgehen, obwohl sie in Romanen notgedrungen zu eindimensionalen Figuren herabgewürdigt werden, nahezu verkommen. Vor allem, wenn „er“ sich eigentlich selbst meint und sich nur hinter dieser dritten Person verstecken will, was Autoren ja häufig machen, um „Helden“ menschlicher und ihre Handlungen nachvollziehbarer zu machen. Auch diesen Satz verwarf ich bald wieder und begann so: „Der Himmel war kornblumenblau. Er sah sie schon von weitem und wollte sich ihr aber nicht bemerkbar machen, denn ihm war, als würde er eine der Grazien Boticellis belauschen. Nicht sie, die den Frühling darstellte, nein, den zu Ende gehenden Sommer in seiner ausladenden Fülle.“
Nachdem ich den Satz nicht nur auf seine Tauglichkeit als Vorbereitung auf einen ersten Plot, wie man die Hinführung auf einen ersten Höhepunkt in der Filmsprache nennt, geprüft hatte, sondern vor allem darauf, ob er seinem Verzicht auf Ort und Zeit (warum eigentlich diese puritanischen Auflagen?) nachkommt, musste ich ihn wieder fallen lassen. „Ist der Himmel nicht auch ein Ort?“, fragte ihn jetzt die Stimme, die er doch eben beruhigt zu haben geglaubt hatte. „Ja, aber für Tote, wollte ich ihr antworten, verbesserte aber und meinte, für religiös gestimmte Menschen.“
„Gut, wir wollen nicht so genau sein!, aber das Kornblumenblau? Ist es nicht die Blume Wilhelm II, der sie im Knopfloch trug und später derjenigen, die sich dem Großdeutschen Reich verbunden fühlten? Oder ist sie ganz harmlos und deutet schon als Farbe auf Sommer und damit auf eine bestimmte Jahreszeit hin, wie du ja im drauffolgenden Satz bestätigst?“, fragt die Stimme glockensüß und triumphierend. „Und das mit der ausladenden Fülle… wie meinst du das? Ist sie vielleicht dick?“
Dieser Einwand gab mir, der ich ein Schriftsteller werden wollte, den Rest. „Du hast gewonnen“, sagte ich resigniert. Aber nur für heute. Morgen versuche ich es mit einem anderen Anfang. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du wirst schon sehen.“
„Da bin ich aber neugierig.“, meinte sie, aber sie sagte es nicht so, als sollte ich es als eine Ermutigung verstehen.
Views: 21

No Comments