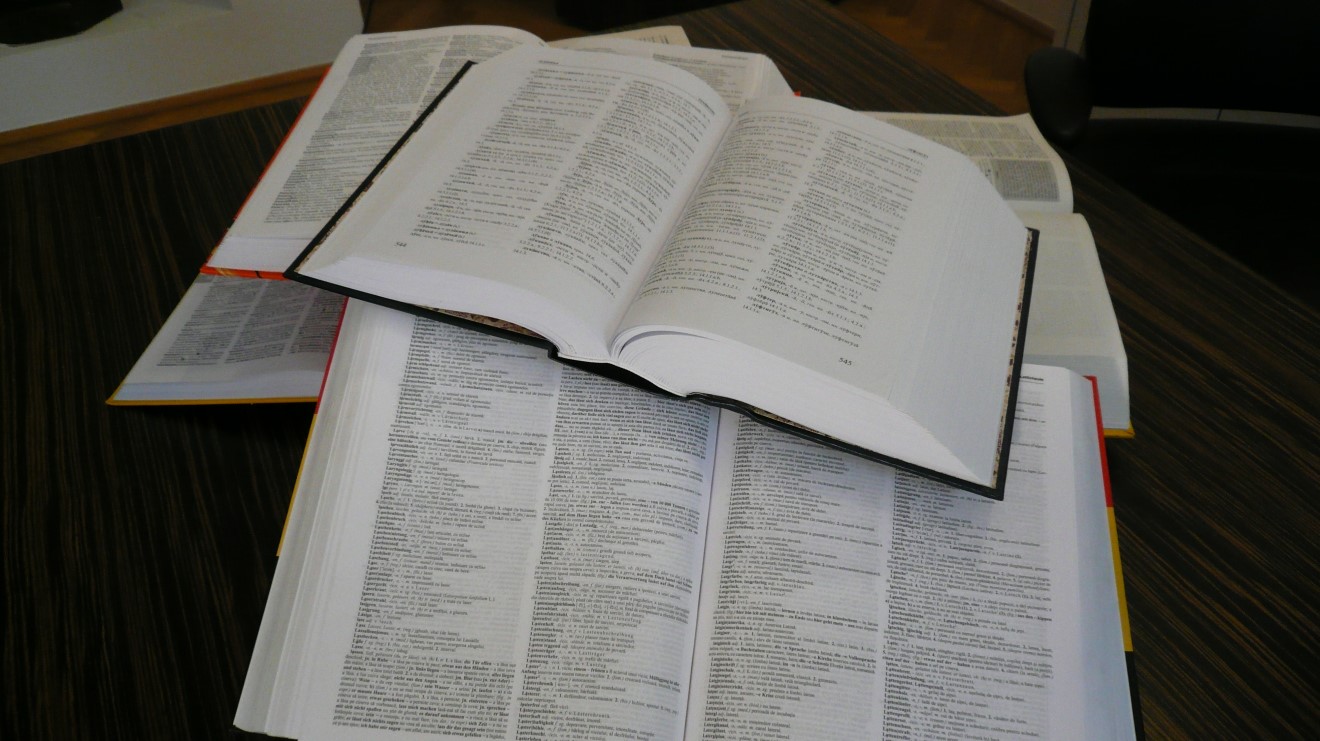
20 Feb. Gustav B.: Eine folgenschwere Recherche
- April
Die vorrätige Zeit, die ich einmal nicht mehr sinnsuchend verbringen zu müssen gedachte, blieb ungenutzt. Wie ein Schnellzug in der Nacht rast sie dahin, um mich an meinen Bestimmungsort zu bringen. Vorbei an Bahnhöfen, wo mich diensthabende Stellwerkleiter durchwinken, in deren Träume ich mich einschleichen will, um teilzuhaben an ihrer Welt. Schatten sind es, die mir den Rücken zukehren und nie mir ihr Gesicht zeigen. Gesichter, die von bleierner Müdigkeit gezeichnet sind, hätte ich sie sehen können. Die einzigen Lebewesen, die um diese Zeit noch wach sind und meine Schlaflosigkeit mit mir teilen, wie trockenes Brot; ausgestreut, den Weg wieder zu finden, den Weg zurück, ohne zu bedenken, dass diese Krumen Beute von Vögeln sein werden, kaum, dass ein neuer Tag beginnt. Kein Traum würde mir bleiben. Kein einziger. Nicht einmal ein Bild. Nur eine Stimmung, zu der Bilder gedacht werden konnten, um aus ihnen einen Traum zu schmieden, der auch am nächsten Morgen noch da sein würde. Immer. Und stets der gleiche, denn ich höre ihn schon wieder, den beinahe lautlosen Schlag ihrer Flügel, aber kann sie nicht sehen.
Mehr?
„Zurück? Wohin zurück?“, fragt Gustav B. in seinem Tagebuch, dessen Aufzeichnungen spärlicher wurden in seinen letzten Jahren und manchmal nur aus einzelnen Sätzen bestanden, einer Anhäufung von Banalitäten neben angedeuteten Geschichten, steinbruchartigen Rohentwürfen für einen Roman, Aufzeichnungen aus seinem Alltag, die mir als seinem Freund anvertraut worden waren, nachdem ihn ein plötzlicher Tod, dessen Ursachen bis heute im Dunkeln blieben, von unserer Seite gerissen hatte. Seine hochbetagte Mutter hatte es mir zugesteckt. Sie waren einer seiner besten Freunde, hat sie gesagt. Sie haben ihn gut gekannt. Ich glaube, ich handle in seinem Sinne, wenn ich ihnen sein Tagebuch gebe. Vielleicht finden sie einen versteckten Hinweis darauf, wer dieses tödliche Spiel mit ihm gespielt hat. Dann nahm sie meine beiden Hände und schaute mir dabei fragend, aber gleichzeitig auch hilfesuchend in die Augen: Sie teilen doch hoffentlich nicht die Ansicht der Polizei? Mein Sohn ist kein Selbstmörder. War, wollte ich sagen. Ließ es aber.
Froh, der dunklen und ziemlich verwahrlosten Wohnung seiner Mutter entkommen zu sein, sitze ich nun in einem Vorstadtlokal und blättere bei einem Glas sauer schmeckendem Schankwein in seinem Tagebuch: Keine Offenbarung, wie ich schnell und zu meinem Bedauern feststellen muss. Ein Durcheinander von Notizen, plan- und schnörkellos. Aber es ist mir ja nicht anvertraut worden, um es auf seine literarische Qualität zu prüfen, obwohl sich mein Freund zeitlebens als Schriftsteller verstanden hatte, ohne je etwas veröffentlicht zu haben. Ich muss allerdings zugeben, dass mich manche Stellen in dem nun vor mir liegenden Tagebuch, aus dem ich schon zitiert habe, auf eine seltsame Weise ansprechen. Es ist ein mir unbekanntes Ich meines Freundes, das da zu mir spricht. Ich kannte ihn ja als einen lebensfrohen und lebensbejahenden Menschen…
- November
Immer kommt mir vor, als wäre mir der Tag geraubt. Immer ist schon Abend, mit dem er beginnt. Der einzige Anruf, den ich heute erhielt, war der einer Frau, die sich als die Gattin des Steinmetzen vorstellte, die ich unlängst aufgesucht habe, damit die Namenszüge auf dem Grabstein, die verblasst sind, wieder lesbar werden. Lesbar für wen? Das Grab meines Vaters, das auch einmal meines sein wird, schaut nicht so aus, als würde es oft besucht werden.
- November
Sie hatte im Freien gesessen mitten in einem Wald von ausgestellten Grabsteinen, auf denen noch die Namen derer fehlten, für die sie bestimmt sein würden, und feilte ihre Fingernägel. Vor sich eine Tasse Kaffee und eine Schachtel Zigaretten neben einer Zeitschrift, die mit der Schlagzeile darauf aufmerksam machen wollte, dass ein Eisbär im Zoo einen Pfau gerissen hat. Sie zählte die Buchstaben und Zahlen auf dem Foto, das die verblassenden Schriftzüge auf dem Grabstein zeigten, und sagte, den Rauch ihrer Zigarette mir entgegen blasend, nachdem sie mit dem Zählen fertig war: Das macht 107. Ein erschwinglicher Preis, wenn man bedenkt, dass es zwei Vornamen und Nachnamen sind, von denen aber nur einer beides, nämlich Geburts- und Sterbedaten aufweist. Auch die Punkte dazwischen werden mitgezählt. Das Ganze zwei Drittel billiger als die Rechnung eines Konkurrenten ein paar Meter vorher, der sich diese Mühe erst gar nicht gemacht hatte, denn für diesen hatte ein kurzer Blick auf das Foto genügt, um – mit dem Stift schon in der Hand, den Auftrag entgegen zu nehmen -, das Dreifache zu fordern. Ein guter Preis, dachte ich also, und erteilte den Auftrag. Schicken sie mir die Rechnung, aber sie müssen mir versprechen, dass ich meinen Namen nicht erst wieder lesen kann, wenn ich tot bin. Für sie war es kein Scherz. Einer von diesen verrückten Kunden, die sich ein etwas makabres Späßchen erlauben. Das wird sie gedacht haben ihrem seltsamen Glucksen nach zu schließen.
Um nachzusehen, ob die Arbeit auch ihr Geld wert war, bin ich heute wieder auf dem Friedhof gewesen. Dort sah ich eine noch junge Frau vor einem Grab stehen, dessen Grabstein alle anderen überragte. Sie trug rote, hochhackige Schuhe und einen trotz sommerlicher Temperatur beige-farbenen Kaschmirmantel mit hochgestelltem Kragen. Da sich ihre Lippen bewegten, nahm ich an, dass sie betete oder im Zwiegespräch mit dem Verstorbenen war. Ihr erst kürzlich durch frühen Tod überraschte Ehemann? Ihr nach langem Leiden durch Tod erlöste Vater? Keine Grabinschrift, soweit ich das von der nächsten Gräberreihe aus sehen konnte, wollte mir das Rätsel erschließen. Ein mannsgroßer Engel stattdessen, der aus dem Stein herausgemeißelte Rosen in der Hand hielt, die ihm wie selbstvergessen aus der Hand und auf das Grab fielen, das wie die anderen mit wuchtigen Steinplatten beschwert war. In diese waren Ringe eingelassen, damit sie bei Bedarf aufgehoben werden konnten, um wieder einen Toten aufzunehmen. Der schwarzverwitterte und an manchen Stellen brüchig gewordene Sandstein, aber auch die moosbewachsenen Steinplatten und mit Grünspan überzogenen Kupferringe ließen auf beträchtliches Alter schließen.
Eigentlich war ich ja hier, um nach dem Grab zu sehen. Mich hält es dort nie lange. Ich zupfe Unkraut, das trotz Vlies das weiße Kiesbett durchwuchert, versuche das aus den Angeln gehobene Türchen des ewigen Lichtes zu schließen, das ich längst schon durch ein Neues ersetzen müsste, fege mit meinem Schlüssel den eingetrockneten Vogelkot von der Fassung des Grabes und kratze die verblassten Buchstabengravuren aus dem Stein. Alles Verlegenheitsgesten. Und beten? Die Erfindung eines Gottes zulassen, um mich mit der Ungerechtigkeit des Sterbenmüssens auszusöhnen? Und außerdem: Ich muss mich doch nicht hier am Grab verorten, um an sie zu denken. Denn das tue ich auch, wenn ich es nicht aufsuche. Heute aber – und ich schreibe es in der noch immer gleichen fiebrigen Erregung, die mich dort erfasst hat – tue und denke ich nichts dergleichen. Ein Blick auf den Grabstein ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Das konnte nicht sein. Aus Kostengründen und weil ich wusste, dass es einmal auch mein Grab sein würde, habe ich auch meinen Namen mit Geburtsdatum eingravieren lassen. Ein etwas morbides, aber durchaus übliches Vorgehen, sich auf diese Weise seine Sterblichkeit vor Augen zu halten und Nachkommen Kosten zu ersparen. Nachkommen? Sie werden das Grab auflösen lassen, kaum, dass ich unter der Erde bin.
Mit diesen Gedanken war ich beschäftigt, als mir plötzlich… Da muss ein Irrtum vorliegen oder sich jemand einen üblen Scherz mit mir erlaubt haben, denn jetzt waren Tag und Jahr meines Todes auf dem Stein zu lesen. Und wenn mir nicht alle Kalender einen Streich spielen, hat dieses Ereignis gestern stattgefunden, obwohl der Steinbildhauer heute schwört, dass er es nicht gewesen sei.“
Ich blättere weiter, aber es gibt keine Eintragungen mehr. Jetzt erst war meine Neugier bis zum Äußersten gereizt. Dem musste ich nachgehen. Das erste war, mich im Netz schlau zu machen, ob mein Freund Nachkommen hatte. Eigentlich müsste ich es wissen. Wir kannten uns seit der Schulzeit und hatten über all die Jahre engen Kontakt gepflegt. Meine Nachforschungen ergaben nichts. Vielleicht kann mir seine Mutter Auskunft geben, war mein nächster Gedanke. Gleich machte ich mich auf den Weg. Ich ging die Straße auf und ab und suchte das Haus, in welchem ich unlängst seine Mutter aufgesucht hatte. Zwischen den Häusern klaffte eine Baugrube. Kräne standen da. Der Aushub für den Keller war fertig. Emsiges Getriebe. Lastfahrzeuge kamen und fuhren den Schutt weg. „Ein Haus? Nein: Hier hat nie ein Haus gestanden. Und wenn, dann ist das Jahre her. Nicht, dass ich wüsste. Bin hier aufgewachsen. Den Namen hab ich nie gehört. Sie müssen sich in der Adresse irren.“ Ich hatte einen älteren Herrn aufgehalten, der gerade aus dem Haus kam, das an die Baugrube angrenzte. Jetzt aber wollte ich es wissen. Um mir Gewissheit zu verschaffen, machte ich mich auf den Weg zum Friedhof. In der Leitstelle wurde mir die Auskunft erteilt, dass es auf diesem Friedhof nie ein Grab mit diesem Namen gegeben habe. Es gäbe noch andere Friedhöfe, wo ich es versuchen könne. Ein Zentralregister, in welchem die Namen aller Toten und Begrabenen aufgelistet sind? Nein: Das gibt es nicht. Nicht, dass sie wüsste. Tut mir leid. Die Dame am Schalter zuckte mit den Achseln und ließ mich stehen.
Das alles hätte schon genügen müssen, an meinem geistigen Zustand zu zweifeln, aber noch fehlte der letzte Beweis, der die Frage nicht mehr offen ließ, ob mein Verstand nicht schon vollends zerrüttetet war, und ich psychischen Beistands in einer Anstalt bedurfte. Zuhause angekommen, suchte ich das Tagebuch: Quelle meiner Neugier, die mich vor ein nicht lösbares Rätsel gestellt hat. Es war nicht mehr auffindbar.
Views: 10

Franz Hartmann
Posted at 17:42h, 21 FebruarSpannend, für mich ähnlich Edgar Allen Poe, von dem habe ich vor vielen Jahren alles gelesen!